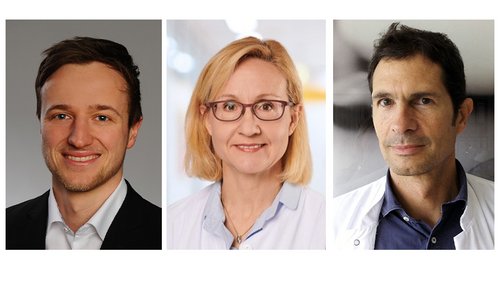Wissenschaftler*innen des Universitätsklinikums Ulm (UKU) haben in einer Kooperationsarbeit die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln überprüft, die bei der Behandlung von Patient*innen mit Alzheimer oder Demenz zum Einsatz kommen. Sie wollten wissen, wie diese Medikamente bei gebrechlichen Patient*innen wirken und konnten aufzeigen, dass ältere gebrechliche Alzheimer Patient*innen in den meisten klinischen Studien zur medikamentösen Therapie von Alzheimer und Demenz nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Die Gesellschaft wird immer älter, Menschen über 75 Jahre sind die am schnellsten wachsende demografische Gruppe der Welt. Die Gesundheitssysteme weltweit müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Denn mit dem zunehmenden Alter der Bevölkerung verändern sich auch die Anforderungen an die medizinische Versorgung. Erkrankungen, die mit dem Lebensalter in Verbindung stehen, wie etwa die Alzheimer-Krankheit, Demenz oder eine generelle körperliche Gebrechlichkeit, rücken in den Fokus. Bei vielen Alzheimer-Patient*innen geht die Erkrankung auch mit Gebrechlichkeit oder funktionellen Beeinträchtigungen einher. Patient*innen sind dann chronisch weniger belastbar und haben weniger Kraftreserven. Damit sind sie anfälliger für weitere Erkrankungen, Behinderungen oder Stürze. Verschiedene körperliche Einschränkungen und Beschwerden wie Schwindel, Schmerzen und Verdauungsstörungen können zeitgleich auftreten und die Lebensqualität weiter beeinträchtigen. „Dadurch scheinen die schädlichen Folgen einer Krankheit – bis hin zum Tod – wahrscheinlicher zu werden. Es gibt außerdem immer mehr Hinweise darauf, dass gebrechliche Alzheimer-Patientinnen und -Patienten ein höheres Risiko für Nebenwirkungen haben, die auf Medikamente zurückzuführen sind“, erklärt Prof. Carlos Schönfeldt-Lecuona, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III und Mitautor der Studie. „Wirft man einen Blick auf die Weltliteratur, erfährt man, dass es bisher keine Studien gibt, die systematisch überprüft haben, wie sich medikamentöse Therapien bei Alzheimer- oder Demenz-Patientinnen und Patienten auswirken, wenn eine Gebrechlichkeit vorhanden ist“, so Prof. Schönfeldt-Lecuona. Forschende des UKU sind in einer Kooperationsarbeit deshalb genau dieser Frage nachgegangen. Zusammen mit der Agaplesion-Bethesda Klinik Ulm, der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und der Cochrane-Collaboration (Freiburg) haben die Wissenschaftler*innen eine vom Land Baden-Württemberg geförderte Studie durchgeführt, die auch im renommierten internationalen Journal Alzheimer's Research & Therapy erschienen ist.
Das Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit und Sicherheit der Arzneimittel zu überprüfen, die bei der Behandlung von Patient*innen mit Alzheimer oder Demenz zum Einsatz kommen. Dafür wurde eine systematische Literaturrecherche in verschiedenen internationalen Datenbanken durchgeführt. Die Wissenschaftler*innen haben 45.045 Artikel identifiziert. 38.447 Abstracts und 187 Volltexte wurden gesichtet. Schließlich wurden 10 randomisierte kontrollierte Studien in die systematische Übersicht aufgenommen. Aus den ausgewählten Artikeln wurden die am häufigsten verwendeten Medikamente für die untersuchte Patientengruppe bewertet. Die Studien zu Antidementiva, also Medikamenten die Gedächtnisfunktionen sowie Konzentrations-, Lern- und Denkfähigkeit verbessern können, deuten darauf hin, dass auch Patient*innen mit funktioneller Beeinträchtigung leichte, aber signifikante Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten aufwiesen und dass die Medikamente allgemein gut verträglich sind. Die Studien zu Antidepressiva, also Medikamenten die unter anderem zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden, zeigten keine signifikanten Verbesserungen der depressiven Symptome der Patientengruppe. Die häufig eingesetzten Antipsychotika und Antikonvulsiva sind Arzneimittel, die hemmend auf die Aufnahme von Innen- und Außenreizen und ordnend auf Wahrnehmung und Denken wirken. Sie zeigten bei einigen Demenz-Patienten eine allenfalls geringe Wirkung, aber bei funktionell beeinträchtigten Patient*innen auch höhere Nebenwirkungsraten.
„Die geringe Anzahl in Frage kommender Studien zeigt deutlich, dass ältere gebrechliche Alzheimer Patientinnen und Patienten in den meisten klinischen Studien zur medikamentösen Therapie von Alzheimer und Demenz nicht ausreichend berücksichtigt werden“, erklärt die Seniorautorin der Studie Prof. Christine von Arnim, Direktorin der Abteilung für Geriatrie der Universitätsmedizin Göttingen. Konkrete Empfehlungen zur gezielten medikamentösen Therapie bei älteren Alzheimer- oder Demenz-Patient*innen mit erheblichen funktionellen Beeinträchtigungen oder Gebrechlichkeit können aufgrund der geringen Datenlage nicht gegeben werden. Was die Studie jedoch zeigt: Antidementiva sind am besten verträglich und führen zur signifikanten Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten. Antidepressiva sollten nur nach harter Indikation gegeben werden. Antikonvulsiva und Antipsychotika verursachen Nebenwirkungen in dieser Patientengruppe, deren gewünschte Wirkung kann durch die aktuelle Analyse nicht endgültig bewertet werden. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei künftigen Studien die besondere Fokussierung auf gebrechliche, ältere Menschen von großer Bedeutung ist“, plädiert der Erstautor der Veröffentlichung, Moritz Seibert, Doktorand an der Universität Ulm der große Teile dieser Arbeit im Rahmen seiner Promotion durchführte. “Eine standardisierte Berücksichtigung für körperliche Gebrechlichkeit in zukünftigen klinischen Studien wäre sehr wünschenswert.“